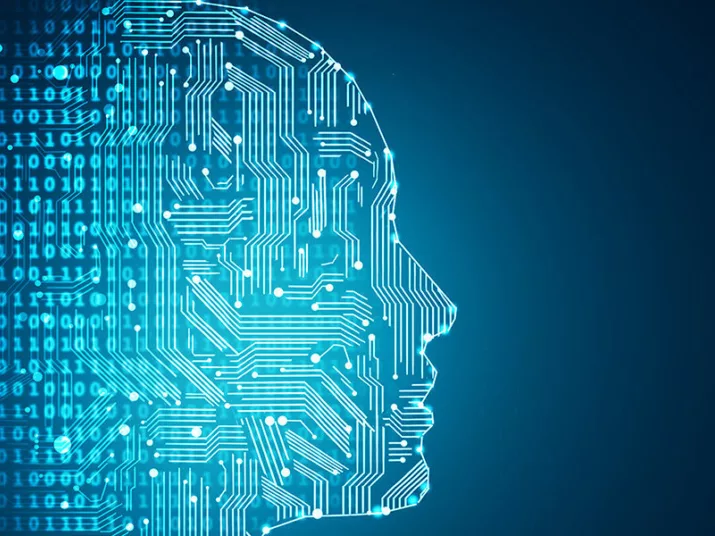
Digitaler Wandel: Deutschlands Schicksal oder Deutschlands Zukunft?
"Die Zeit ist reif, vielleicht schon überreif, um eine gesellschaftliche Debatte zu führen, die sich um die eine entscheidende Frage dreht: Wie wollen wir leben? Diese generelle Frage hat viele konkrete Ausformungen: Welches Maß an Digitalisierung streben wir als Gesellschaft an?"
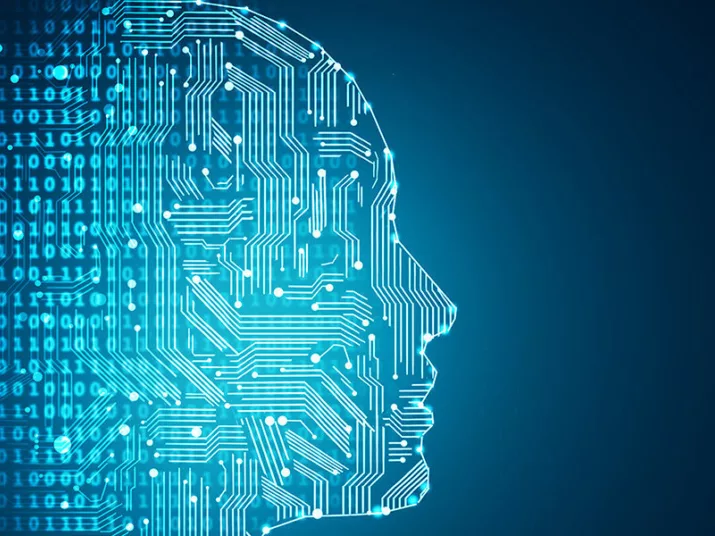
Von Dr. Stefan Brandt
Die gute Nachricht zuerst: Der digitale Wandel ist im gesellschaftlichen Diskurs angekommen.
Das ist keineswegs selbstverständlich, blieb doch das Thema im vergangenen Bundestagswahlkampf eher eine Randerscheinung. Eine breitere Debatte über Chancen und Risiken der kommenden digitalen Revolution fand nicht statt. Seit Ende des Wahlkampfs mehren sich nun die Anzeichen, dass es mit dem Nischendasein des Themas vorbei ist. In den Sondierungen und Koalitionsverhandlungen der vergangenen Monate nahm es eine prominentere Rolle ein, als man nach den Eindrücken des Wahlkampfes erwarten konnte.
Die schlechte Nachricht: Es gibt derzeit noch nicht einmal ansatzweise einen gemeinsamen Nenner darüber, was mit digitalem Wandel eigentlich gemeint ist. Manche verstehen darunter die flächendeckende Versorgung mit Highspeed-Internet, bei der Deutschland in der Tat Nachholbedarf hat. Andere sehen die Vernetzung der Schulen als vordringlich an. Wieder andere führen das Schlagwort von der „Industrie 4.0“ im Munde, wobei selten genauer erläutert wird, wodurch sich eigentlich „4.0“ von „3.0“ unterscheidet. Wieder andere fürchten die Ablösung der Menschen durch die Roboter, wie es sinnfällig das Titelbild eines „New-Yorker“-Heftes aus dem Herbst 2017 zeigt: Roboter eilen geschäftig durch eine Straße, ab und zu werfen sie Münzen in den Becher eines Bettlers. Er ist das einzige verbliebene menschliche Wesen in der Maschinenwelt.
DIE GROSSEN VERÄNDERUNGEN
Einig scheint man sich immerhin in dem noch einigermaßen diffusen Gefühl zu sein, dass die Digitalisierung große Veränderungen mit sich bringen wird. Und dieses Gefühl trifft sich mit den Erkenntnissen praktisch aller näher mit der Materie Befassten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Kunst. Vieles spricht dafür, dass der digitale Wandel unser Leben in den kommenden Jahren in einer Weise auf den Kopf stellen wird, wie wir es uns heute nur schwer vorstellen können. Drei große Entwicklungen zeichnen sich dabei ab:
- Der bereits begonnene Prozess der Vernetzung von Daten wird sich beschleunigen und ausweiten.
„Big Data“ entwickelt sich zu einer alle Lebensbereiche durchdringenden Realität. Ein Beispiel: Messwerte aus Gesundheits-Checkups, die wir bereits jetzt selbst mit Hilfe unserer Smartphones erstellen, könnten mit den Daten unseres Einkaufsverhaltens im Internet oder in „smarten“ Supermärkten verbunden werden. Auf diese Weise ließe sich gesundheitsbewusste Ernährung wirkungsvoll unterstützen – allerdings ist damit auch mehr Kontrolle des Einkaufsverhaltens verbunden. Wollen wir das? - Die Grenze zwischen Mensch und Maschine wird durchlässig.
„Cyborgs“ gehören bald zum Alltag. Freilich sind hier nicht Horrorwesen à la Robocop gemeint, sondern technische Hilfsmittel, die uns den Umgang mit krankheitsbedingten Einschränkungen erleichtern. Schon heute werden sogenannte Hirnschrittmacher zur Behandlung von Parkinson eingesetzt. Künftig könnten viele weitere Krankheitsbilder durch technische Unterstützung um ein Vielfaches erträglicher verlaufen. Aber auch für Eigenoptimierung bieten sich neue Perspektiven: Wahrscheinlich wird es irgendwann einmal ohne größeren Aufwand und fast risikolos möglich sein, das eigene Gehirn technisch zu stimulieren, um damit den eigenen Gedanken auf die Sprünge zu helfen. Wollen wir das? - Die Künstliche Intelligenz (KI) stößt in Bereiche vor, die bislang noch als Domäne der Menschen gelten.
Damit einher geht eine Automatisierung in bisher ungekanntem Ausmaß. Wir alle haben uns schon lange daran gewöhnt, dass Roboter die meisten Fließband-Arbeitsplätze überflüssig gemacht haben. Doch sind wird darauf vorbereitet, dass künftig auch Busfahrer*innen, Verkäufer*innen, Bankberater*innen und sogar Professor*innen durch technische Lösungen ersetzt werden können? Ist uns bewusst, dass KI auch in den Bereich des kreativen Schaffens vorstoßen könnte? Schon jetzt sind Maschinen dazu in der Lage, Romane auf Groschenheft-Niveau schreiben. Je leistungsfähiger und lernfähiger die dahinterliegenden neuronalen Netze werden, umso wahrscheinlicher ist es, dass irgendwann einmal Werke entstehen, die wir als künstlerisch hochstehend anerkennen. Schon heute arbeitet der Berliner Maler Roman Lipski mit einer technischen „Muse“ auf Basis von KI zusammen, die ihn durch ihre Assoziationskraft zu neuem Schaffen inspiriert. Doch warum sollte sich die selbstlernende KI mit der Rolle der Muse zufriedengeben? Eine Maschine, die Abermilliarden von Mustern speichert und in Sekundenschnelle analysiert, könnte durch Neukombinationen und Assoziationen in völlig neue Sphären vorstoßen. Wollen wir das?
DIE PERMANENTE DIGITALE REVOLUTION
Alle hier beschriebenen Entwicklungen sind keine Science Fiction, sondern in ihren Anfängen bereits Realität. Und welche Quantensprünge in den nächsten beiden Dekaden bevorstehen könnten, zeigt ein Blick zurück. Vor zwanzig Jahren galten die damaligen klobigen Mobiltelefone noch als Statussymbol weniger Berufsgruppen. Umgerechnet auf die Gesamtbevölkerung betrug der Anteil an Mobilfunkverträgen 1997 nur rund 10 Prozent (rund 8 Millionen). Bis Mitte 2017 ist diese Zahl auf rund 132 Millionen gewachsen, zumeist in Verbindung mit Smartphones. Die digitale Realität ist inzwischen so allgegenwärtig, dass sich Angebote wie „Digital Detox“ – also der Verzicht auf das Smartphone für einige Tage – wachsender Beliebtheit erfreuen. Man bedenke, dass die Vorstellung des ersten iPhones durch Steve Jobs erst 2007 stattfand. Wenn sich in den letzten elf Jahren so viel ändern konnte – was wird dann erst in zwanzig Jahren sein?
Die Mobilfunk-Statistik verweist zugleich auf ein Erfolgsgeheimnis der Digitalisierung. Diese packt uns da, wo wir uns besonders leicht überzeugen, vielleicht auch überrumpeln lassen – bei unserer eigenen Convenience, unserer Bequemlichkeit. Das Smartphone hat vieles für uns leichter gemacht. Ohne größere Anstrengung können wir von fast jedem Ort der Welt aus binnen Sekunden Informationen selbst zu den ausgefallensten Themen abrufen. Ein dickes Brockhaus-Lexikon, früher die Zierde jedes bürgerlichen Wohnzimmers, brauchen wir dazu nicht. Dabei gibt es freilich auch immer weniger Alternativen zu den Quellen des Internets: Der Verkauf der letzten Brockhaus-Ausgabe wurde 2014 eingestellt. Wer hätte dies zwanzig Jahre vorher für möglich gehalten?
Ob wir also die Digitalisierung mögen oder nicht: Wir können bereits heute kaum mehr ein Leben ohne sie führen und treiben den digitalen Wandel täglich weiter voran. Mit jeder neuen App, die wir herunterladen, mit jedem neuen Film, den wir online streamen, bauen wir am digitalen Turm von Babel. Von den Unternehmen, die durch digitale Lösungen neue Märkte erschließen und gigantische Effizienzgewinne erzielen können, ganz zu schweigen. Wir sollten von der Arbeitshypothese ausgehen, dass sich die digitale Revolution fortsetzen und – mit unser aller Hilfe – noch weiter beschleunigen wird. Die Frage ist aber, ob dieser Prozess ungesteuert verlaufen wird oder ob wir es schaffen, ihn zumindest ansatzweise in unserem Sinne zu beeinflussen. Wollen wir passive Erdulder*innen oder aktive Gestalter*innen des sich abzeichnenden Strukturwandels sein?
DIE NOTWENDIGKEIT NEUER DISKURSE
Was die wirtschaftliche Seite dieses Prozesses angeht, stimmt die Tatsache zuversichtlich, dass es Deutschland wie nur wenige andere Länder in Europa geschafft hat, sich technischen Paradigmenwechseln zu stellen. Das war so bei dem Strukturwandel, der die früher so dominante Montanindustrie fast völlig verschwinden ließ, ebenso wie bei den bisherigen Automatisierungs- und Digitalisierungswellen. Immer gelang es, neue Arbeitsfelder zu erschließen und neue Jobprofile zu schaffen. Aus Fließband-Arbeiter*innen wurden Steuernde von Produktionsanlagen – auch dank des international bewunderten betrieblich-schulischen Ausbildungssystems. Bestes Zeugnis für die Adaptionsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist die seit Jahren sinkende Arbeitslosenquote.
Die Erfahrungen der Vergangenheit sind Indiz dafür, dass es gelingen kann, auch mit den kommenden Herausforderungen des digitalen Wandels zurechtzukommen. Dafür genügt es aber nicht, Glasfaserkabel zu verlegen und Regelungen zum Datenschutz auszuarbeiten, so wichtig das im Einzelnen natürlich ist. Es reicht auch nicht, die Entwicklungen einfach abzuwarten und dann zu reagieren. Sonst stellen wir in zehn Jahren vielleicht fest, dass zahlreiche Arbeitsplätze – auch wenn es vermutlich nicht 50 Prozent sein werden, wie es eine ebenso aufsehenerregende wie umstrittene Studie von Carl Benedikt Frey und Michael Osborne 2013 ermittelt hat – in digitalen Lösungen aufgegangen sind, ohne dass es gelungen wäre, ausreichende Alternativen zu schaffen. Selbst der IT-Branchenverband Bitkom befürchtet eine solche Entwicklung. Und so wichtig wirtschaftliche Fragen sind, stellen sie nur einen Teilaspekt der Digitalisierung dar. Wie das „Cyborg“-Beispiel zeigt, müssen in den kommenden Jahren zahlreiche komplizierte ethische Fragen geklärt und dann in rechtssichere Lösungen überführt werden.
Wie wollen wir leben?
Die Zeit ist reif, vielleicht schon überreif, um eine gesellschaftliche Debatte zu führen, die sich um die eine entscheidende Frage dreht: Wie wollen wir leben? Diese generelle Frage hat viele konkrete Ausformungen: Welches Maß an Digitalisierung streben wir als Gesellschaft an? Wo und wie kann uns die Digitalisierung dabei helfen, wichtige Zukunftsherausforderungen – sei es der Klimawandel, der Anstieg chronischer Krankheiten, die Alterung der Gesellschaft oder die Endlichkeit natürlicher Ressourcen – besser zu bewältigen? Wo möchten wir der Digitalisierung aber auch Grenzen ziehen? Welche Tätigkeiten sollen künftig von Menschen ausgeübt werden? Welche Handlungsnotwendigkeiten ergeben sich daraus, etwa für die künftige Berufsausbildung? Welche Konsequenzen sind im Hinblick auf unsere sozialen Sicherungssysteme zu ziehen? Und schließlich: Wie können wir unsere Initiativen international abstimmen und vernetzen, da Digitalisierung und Globalisierung seit jeher Hand in Hand gehen? Auf europäischer Ebene könnte insbesondere Frankreich mit seiner ambitionierten Digitalstrategie ein starker Partner werden.
Die Liste der Fragen ließe sich beliebig fortsetzen und wäre in der Debatte weiter auszudifferenzieren. Zunächst einmal muss aber der Prozess der gegenseitigen Verständigung überhaupt in Gang gebracht werden. Das ist auf verschiedenen Ebenen nötig:
- Auf der ganz persönlichen Ebene kommt es darauf an, dass sich möglichst viele Menschen darüber bewusst werden, dass mit dem digitalen Wandel etwas Entscheidendes auf sie zukommt. Das erfordert, neben der Vermittlung und Erschließung des dafür erforderlichen Wissens, ein inzwischen selten gewordenes Gut: Zeit zur Reflexion. Solange wir damit beschäftigt sind, möglichst jede freie Minute mit (oftmals digitalen) Aktivitäten zu füllen, wird uns das Nachdenken über die Herausforderungen der Digitalisierung nicht gelingen. Es mag paradox klingen: Um das Digitale besser zu verstehen, müssen wir wieder lernen, ein Stück weit analoger zu leben. Das geht bis hinein in die Schulen: Neben der Digitalkompetenz, die künftig dort vermittelt werden soll, müsste es eigentlich ein Fach wie „Reflexionskunde“ geben. Permanente Zerstreuung wird uns vermutlich nicht in die Lage versetzen, unsere vielleicht größte Zukunftsherausforderung zu verstehen und zu bewältigen.
- Auf politischer Ebene muss das Thema Digitalisierung eine höhere Priorität in der Agenda als bislang erhalten. Die Monate seit der Bundestagswahl wecken Hoffnung, dass dies gelingen kann. Neben konkretem tagespolitischen Handeln ist allerdings auch eine ganzheitliche und langfristige Beschäftigung mit dem Thema dringend notwendig, um seiner Bedeutung für unsere Zukunft gerecht zu werden. Warum nicht über eine neue Enquete-Kommission „Den digitalen Wandel gestalten“ im Deutschen Bundestag nachdenken? Sie könnte unter Einbezug aller relevanten Bereiche von der Wissenschaft über die Wirtschaft bis hin zur Kultur und zur Zivilgesellschaft überparteilich und mit langem Atem agieren. Das Instrument der Enquete-Kommission hat sich in den letzten Jahrzehnten durchaus bewährt, um gesellschaftlich besonders relevante Themen zu behandeln und Entscheidungsgrundlagen für die Politik vorzubereiten.
- Die Ebenen der Politik, der Expert*innen und die der „normalen Bürger*innen“ müssen viel enger miteinander in Beziehung gesetzt werden, als dies bei früheren Strukturwandeln der Fall war. Digitalisierung geht uns alle an und wird unser aller Leben beeinflussen. Die Auseinandersetzung über den richtigen Weg und das gesellschaftlich gewünschte Maß muss aus den diversen Echokammern und Filterblasen herausgeholt werden. Im Grunde kann jedes Universitätsinstitut, jedes Unternehmen oder jede Kulturinstitution, die sich mit Fragen der Digitalisierung beschäftigt, zum Ort für derartige Debatten werden und das gegenseitige Verständnis befördern. Vernetzung ist ein Schlüsselbegriff der digitalen Revolution – Vernetzung sollte auch unser Prinzip des Diskurses über die digitale Zukunft sein.
Die Welt kann verändert werden. Zukunft ist kein Schicksal.
Vor einiger Zeit berichteten Medien darüber, dass ein ehemaliger führender Google-Mitarbeiter, Anthony Levandowski, bereits 2015 eine religiöse Vereinigung mit dem Namen „Way of the Future“ in Kalifornien gegründet hat. Ihr erklärtes Ziel ist es, „eine Gottheit basierend auf Künstlicher Intelligenz zu entwickeln und zu unterstützen“. Ja, vielleicht sind die Herausforderungen der künftigen digitalen Gesellschaft zu komplex, als dass sie noch von Menschen bewältigt werden könnten. Vielleicht sollten wir uns dem Algorithmus einer KI-Gottheit unterwerfen, weil wir selbst nicht mehr weiterwissen. Das Orakel von Delphi würde in moderner Form wiederauferstehen und unser Handeln lenken. Doch wäre dies letzten Endes eine Bankrotterklärung, eine selbstgewählte Kapitulation vor einer Entwicklung, die wir selbst herbeigeführt haben. Der Urvater der Zukunftsforschung, Robert Jungk, hätte eine solche passive Haltung zweifellos verworfen. Sein Leitmotiv hieß: Die Welt kann verändert werden. Zukunft ist kein Schicksal. Wir haben es in der Hand, ob die Digitalisierung zu unserem Schicksal oder zu unserer Zukunft wird. Die gesamtgesellschaftliche Debatte darüber muss jetzt beginnen.
Bild: Fotolia